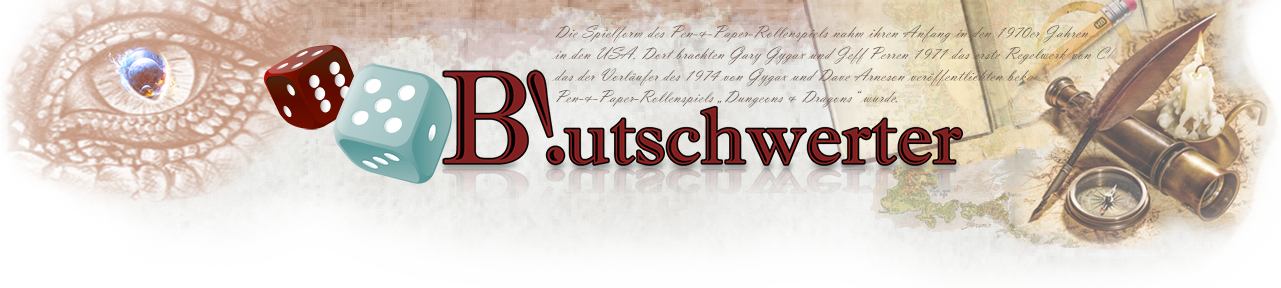Arki
nothing in particular...
- Registriert
- 17. Februar 2004
- Beiträge
- 965
Moin zusammen!
Ich hab das hier in nem anderen Board gepostet, als es u.a. um das Dikssionsthema Federn und Flügel ging.
Ich glaube, innerhalb der biologisch/ medizinischen Ecke gibt es kaum ein komplexeres Thema.
Deshalb poste ich meinen 'Artikel' auch mal hier und wollte damit gleichzeitig anregen, sich mal etwas mehr mit diesem 'fedrigen' Thema auseinanderzusetzen, mit dem Engel tagtäglich zu tun haben.
Vielleicht kommen dann ja noch mehr Fragen und Antworten dazu.
Die Materialsammlung wird dann wohl über kurz oder lang in der Galerie landen.
Also, Vorrede zu Ende, hier ist das Zeugs:
Einige kleine Anmerkungen zum Thema Federn und Flügel.
Ich will hier nicht anfangen zu klugscheißern, ich rekonstruiere nur, was ich aus der Schule und durch Studium und Beobachtung definitiv weiß. Ich beziehe mich hier auch nur auf Vögel, nicht auf Engel.
Ich habe bei meiner Deutung dieser Themen fast alles von den Vögeln übernommen...
Aufplustern von Federn
Federn werden im Großen und Ganzen nicht mit Hilfe von Muskeln aufgeplustert. Der Vogel bläht zum Aufplustern seine Luftsäcke auf. Dadurch bläht und dehnt sich die Haut und die Federn darauf heben ab und sträuben sich.
Diese Luftsäcke sind mit der Lunge verbunden durch ein Schlauchsystem. In den Flügeloberarmen innerhalb des Knochenkerns sitzen welche, rund um die Lunge im Torso ebenfalls.
Ein kleiner Teil dieses 'Federsträubens' geht aber wirklich auf Muskeln zurück. Das ist wie bei uns Menschen eine Gänsehaut bekommen und kann bei Vögeln mehr oder weniger willkürlich gesteuert werden.
Federfett, Federstaub?
Federfett in dem Sinne gibt es bei Engeln wohl nicht. Dazu braucht's eine Bürzeldrüse, die normalerweise bei verschiedenen Vogelarten wie Enten und Gänsen am oberen Übergang von Becken zu Steiß sitzt.
Andere Vogelarten imprägnieren ihr Gefieder ohne Fett mit Hilfe von Puderdaunen. Das sind Daunenfedern, die sich immer wieder unter dem Deckgefieder zu mehlfeinem Staub und Schüppchen zerreiben. Und dieses seifige, leicht fettige Puder verteilen Vögel beim Putzen in und um ihr Deckgefieder. Wenn sie sich schütteln und lange nicht mehr gebadet haben, stäuben sie ziemlich heftig - und riechen mitunter auch ziemlich streng nach dem Zeugs.
Federwachstum
Voll ausgewachsene Federn an sich sind eigentlich nicht lebendig, es sei denn, es handelt sich um eine noch heranwachsende Federspule, die noch nicht ganz aus ihrer Hornhülse raus ist. Auf dem Bild von Thael kann man diese Spulen sehen. das sind die Knubbel, wo sich unten noch kein 'Pinsel' in Form der sich herausschiebenden Federspitze zeigt.
Wachsende Federspulen werden manchmal wegen ihrer naheliegenden roten Farbe auch Blutkiele genannt und sind hohle Röhren, manchmal sogar noch weich, sehr gut durchblutet und mit Nerven durchzogen. Darum tut es dappigen Vögeln auch weh, wenn sie da beim Putzen geistesabwesend reinbeißen...
Je weiter eine Feder sich 'auswächst', desto geringer wird er Anteil an durchblutetem Gewebe im Federkiel, bis die reife Feder am Ende vollkommen verhornt ist und nur noch aus Keratin ohne lebenden Anteil besteht. Beim Wachsen verlängert sich der Blutkiel Stück für Stück. Das vorher durchblutete Innengewebe bildet sich zurück und man bekommt den bekannten hohlen Federkiel.
Eine Feder kann erst dann von alleine ausfallen, wenn sie komplett aus totem Keratin besteht und der Rückhalt in ihrem Federbett nicht mehr vorhanden ist. Die alte Feder wird dann vom Körper abgestoßen und es wächst eine neue heran, die die Stadien Federspule, Blutkiel und heranwachsende Feder wieder mitmacht, bis auch sie komplett abstirbt und abgestoßen wird usw usf.
Verliert ein Vogel vorher eine Feder, dann meist durch äußere Einwirkungen wie Stoß oder Schlag, bzw Verkanten der Feder. Entweder reißt dann ein Stück der Fahne ab, oder der noch lebende Teil des Blutkiels wird ausgerissen. Das ist dann ziemlich schmerzhaft, blutet wie die Sau und der bis dahin noch weiche Teil des Kiels, der bis zu mehrere Zentimeter tief in der Haut eingebettet war, ist dann weich, rosa und oft auch ziemlich blutig.
Federn wachsen übrigens aus denselben Zellverbänden heraus wie Haarfollikel. Früher glaubte man, Federn ähnelten im Aufbau eher Schuppen, aber das stimmt wohl dann auch nicht ganz

Federbewegungen am Flügel
Es ist richtig, Federn können in einem gewissen Maß bewegt werden. Aber das trifft nur für einige wenige Partien am Flügel zu.
Betroffen sind hier vor allem die Hand- und in geringerem Maß auch die Armschwungfedern. Grade die Handschwingen sind an der Flügelhand festgewachsen. Bewegt diese sich, spreizen sich die Federn auf. Das selbe gilt für die Armschwingen.
Muskelbänder und Sehnen am untern Saum von Flügelhand- und Arm sorgen für die nötige Spannung des Gewebes, daß die Federn in ihren Betten in Reih und Glied möglichst parallel ausgerichtet bleiben.
Alles andere, was nach 'Eigenbewegung' aussieht, ist eigentlich keine. Die Drehbewegung der Handschwungfedern in bestimmten Winkeln während Flugmanövern wird eher ausgelöst durch die Luftströmung. Die Federfahnen richten sich meist so aus, daß sie im Luftstrom liegen und nicht daraus herausragen. Sonst reißt der Luftstrom ab und der Vogel beginnt zu trudeln.
Das selbe gilt auch für die sich aufrichtenden Deckfedern bei Landemanövern. Sie beginnen zu flattern und 'stellen sich auf', weil sie Luftverwirbelungen ausgesetzt sind, die entlang der Oberseite an der Vorderkante des Flügels entstehen.
Die beweglichste Federpartie eines Flügels sind die Daumenfittiche.
Das sind zwei kleine padellförmige und absolut unscheinbare Federchen an der Handbeuge.
Da sie mit dem verkümmerten Daumen der Flügelhand verwachsen sind, und dieser nach wie vor eine gewisse Beweglichkeit besitzt, ist diese Federpartie des Flügels die wohl variabelste.
Geschickt ist das auch, weil diese Daumenfittiche Bremsverstärker und Steuerhilfen zugleich sind und so eine ziemlich wichtige Aufgabe bei der Feinsteuerung des Vogelflugs haben.
Brennende Federn?
Zum Thema Brennbarkeit von Federn: die Dinger fangen verflucht schnell Feuer.
Einziger Trost dabei ist, daß sie schnell wieder verlöschen. Aber wenn's ganz blöd läuft, sind ruckzuck ein paar Quadratzentimeter oder mehr davon weg (hab grad mal ne Nymphiefeder testweise angefackelt). Ach ja, und das stinkt! *naserümpf* Irgendwie nach verbrannten Frikadellen...
Ein kräftiger Luftzug oder energisches Flügelschlagen müßte aber reichen, um die Flammen zu löschen.
Verwandte Themen:
Ich hab das hier in nem anderen Board gepostet, als es u.a. um das Dikssionsthema Federn und Flügel ging.
Ich glaube, innerhalb der biologisch/ medizinischen Ecke gibt es kaum ein komplexeres Thema.
Deshalb poste ich meinen 'Artikel' auch mal hier und wollte damit gleichzeitig anregen, sich mal etwas mehr mit diesem 'fedrigen' Thema auseinanderzusetzen, mit dem Engel tagtäglich zu tun haben.
Vielleicht kommen dann ja noch mehr Fragen und Antworten dazu.
Die Materialsammlung wird dann wohl über kurz oder lang in der Galerie landen.
Also, Vorrede zu Ende, hier ist das Zeugs:
Einige kleine Anmerkungen zum Thema Federn und Flügel.
Ich will hier nicht anfangen zu klugscheißern, ich rekonstruiere nur, was ich aus der Schule und durch Studium und Beobachtung definitiv weiß. Ich beziehe mich hier auch nur auf Vögel, nicht auf Engel.
Ich habe bei meiner Deutung dieser Themen fast alles von den Vögeln übernommen...
Aufplustern von Federn
Federn werden im Großen und Ganzen nicht mit Hilfe von Muskeln aufgeplustert. Der Vogel bläht zum Aufplustern seine Luftsäcke auf. Dadurch bläht und dehnt sich die Haut und die Federn darauf heben ab und sträuben sich.
Diese Luftsäcke sind mit der Lunge verbunden durch ein Schlauchsystem. In den Flügeloberarmen innerhalb des Knochenkerns sitzen welche, rund um die Lunge im Torso ebenfalls.
Ein kleiner Teil dieses 'Federsträubens' geht aber wirklich auf Muskeln zurück. Das ist wie bei uns Menschen eine Gänsehaut bekommen und kann bei Vögeln mehr oder weniger willkürlich gesteuert werden.
Federfett, Federstaub?
Federfett in dem Sinne gibt es bei Engeln wohl nicht. Dazu braucht's eine Bürzeldrüse, die normalerweise bei verschiedenen Vogelarten wie Enten und Gänsen am oberen Übergang von Becken zu Steiß sitzt.
Andere Vogelarten imprägnieren ihr Gefieder ohne Fett mit Hilfe von Puderdaunen. Das sind Daunenfedern, die sich immer wieder unter dem Deckgefieder zu mehlfeinem Staub und Schüppchen zerreiben. Und dieses seifige, leicht fettige Puder verteilen Vögel beim Putzen in und um ihr Deckgefieder. Wenn sie sich schütteln und lange nicht mehr gebadet haben, stäuben sie ziemlich heftig - und riechen mitunter auch ziemlich streng nach dem Zeugs.
Federwachstum
Voll ausgewachsene Federn an sich sind eigentlich nicht lebendig, es sei denn, es handelt sich um eine noch heranwachsende Federspule, die noch nicht ganz aus ihrer Hornhülse raus ist. Auf dem Bild von Thael kann man diese Spulen sehen. das sind die Knubbel, wo sich unten noch kein 'Pinsel' in Form der sich herausschiebenden Federspitze zeigt.
Wachsende Federspulen werden manchmal wegen ihrer naheliegenden roten Farbe auch Blutkiele genannt und sind hohle Röhren, manchmal sogar noch weich, sehr gut durchblutet und mit Nerven durchzogen. Darum tut es dappigen Vögeln auch weh, wenn sie da beim Putzen geistesabwesend reinbeißen...
Je weiter eine Feder sich 'auswächst', desto geringer wird er Anteil an durchblutetem Gewebe im Federkiel, bis die reife Feder am Ende vollkommen verhornt ist und nur noch aus Keratin ohne lebenden Anteil besteht. Beim Wachsen verlängert sich der Blutkiel Stück für Stück. Das vorher durchblutete Innengewebe bildet sich zurück und man bekommt den bekannten hohlen Federkiel.
Eine Feder kann erst dann von alleine ausfallen, wenn sie komplett aus totem Keratin besteht und der Rückhalt in ihrem Federbett nicht mehr vorhanden ist. Die alte Feder wird dann vom Körper abgestoßen und es wächst eine neue heran, die die Stadien Federspule, Blutkiel und heranwachsende Feder wieder mitmacht, bis auch sie komplett abstirbt und abgestoßen wird usw usf.
Verliert ein Vogel vorher eine Feder, dann meist durch äußere Einwirkungen wie Stoß oder Schlag, bzw Verkanten der Feder. Entweder reißt dann ein Stück der Fahne ab, oder der noch lebende Teil des Blutkiels wird ausgerissen. Das ist dann ziemlich schmerzhaft, blutet wie die Sau und der bis dahin noch weiche Teil des Kiels, der bis zu mehrere Zentimeter tief in der Haut eingebettet war, ist dann weich, rosa und oft auch ziemlich blutig.
Federn wachsen übrigens aus denselben Zellverbänden heraus wie Haarfollikel. Früher glaubte man, Federn ähnelten im Aufbau eher Schuppen, aber das stimmt wohl dann auch nicht ganz
Federbewegungen am Flügel
Es ist richtig, Federn können in einem gewissen Maß bewegt werden. Aber das trifft nur für einige wenige Partien am Flügel zu.
Betroffen sind hier vor allem die Hand- und in geringerem Maß auch die Armschwungfedern. Grade die Handschwingen sind an der Flügelhand festgewachsen. Bewegt diese sich, spreizen sich die Federn auf. Das selbe gilt für die Armschwingen.
Muskelbänder und Sehnen am untern Saum von Flügelhand- und Arm sorgen für die nötige Spannung des Gewebes, daß die Federn in ihren Betten in Reih und Glied möglichst parallel ausgerichtet bleiben.
Alles andere, was nach 'Eigenbewegung' aussieht, ist eigentlich keine. Die Drehbewegung der Handschwungfedern in bestimmten Winkeln während Flugmanövern wird eher ausgelöst durch die Luftströmung. Die Federfahnen richten sich meist so aus, daß sie im Luftstrom liegen und nicht daraus herausragen. Sonst reißt der Luftstrom ab und der Vogel beginnt zu trudeln.
Das selbe gilt auch für die sich aufrichtenden Deckfedern bei Landemanövern. Sie beginnen zu flattern und 'stellen sich auf', weil sie Luftverwirbelungen ausgesetzt sind, die entlang der Oberseite an der Vorderkante des Flügels entstehen.
Die beweglichste Federpartie eines Flügels sind die Daumenfittiche.
Das sind zwei kleine padellförmige und absolut unscheinbare Federchen an der Handbeuge.
Da sie mit dem verkümmerten Daumen der Flügelhand verwachsen sind, und dieser nach wie vor eine gewisse Beweglichkeit besitzt, ist diese Federpartie des Flügels die wohl variabelste.
Geschickt ist das auch, weil diese Daumenfittiche Bremsverstärker und Steuerhilfen zugleich sind und so eine ziemlich wichtige Aufgabe bei der Feinsteuerung des Vogelflugs haben.
Brennende Federn?
Zum Thema Brennbarkeit von Federn: die Dinger fangen verflucht schnell Feuer.
Einziger Trost dabei ist, daß sie schnell wieder verlöschen. Aber wenn's ganz blöd läuft, sind ruckzuck ein paar Quadratzentimeter oder mehr davon weg (hab grad mal ne Nymphiefeder testweise angefackelt). Ach ja, und das stinkt! *naserümpf* Irgendwie nach verbrannten Frikadellen...
Ein kräftiger Luftzug oder energisches Flügelschlagen müßte aber reichen, um die Flammen zu löschen.
Verwandte Themen: